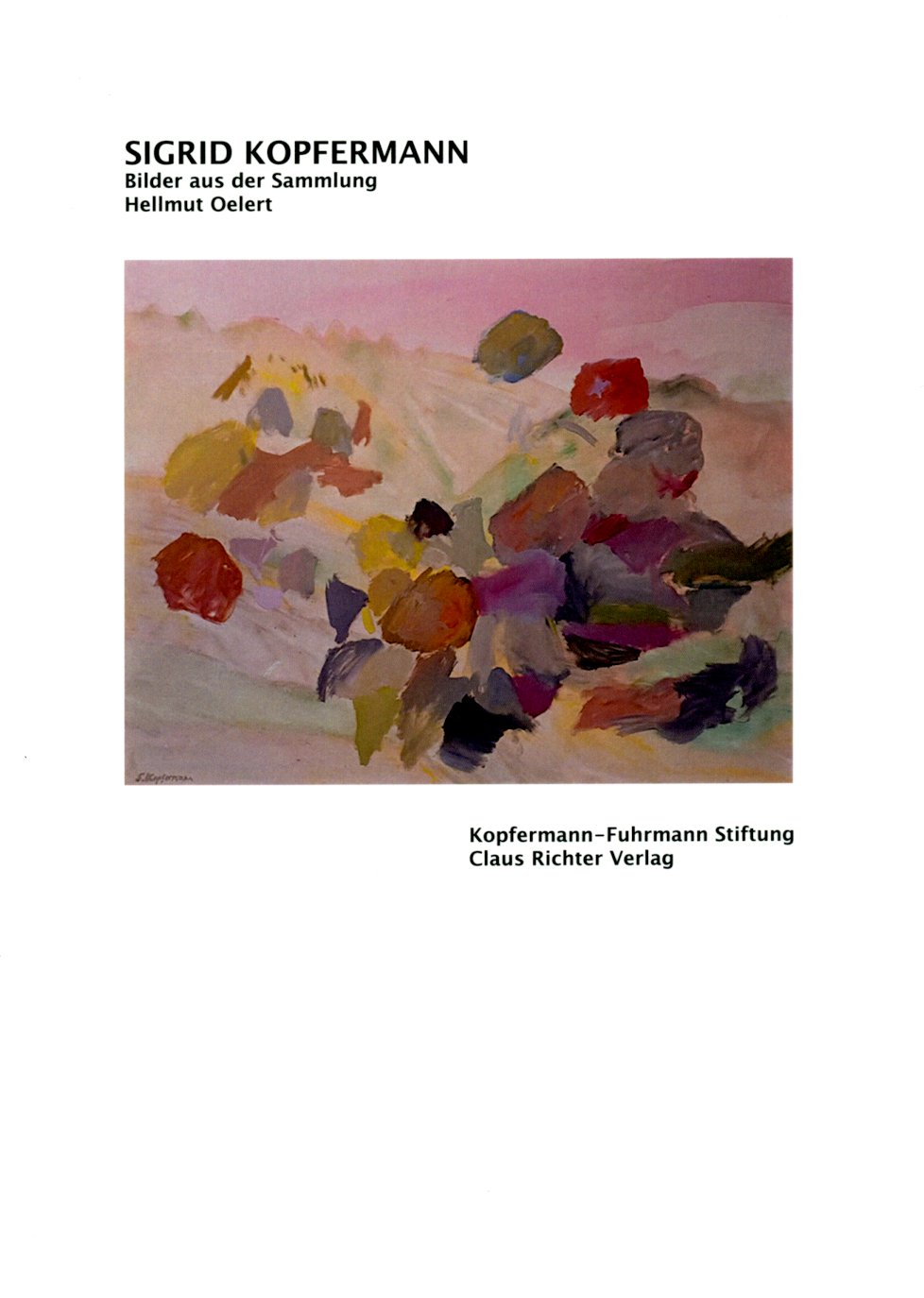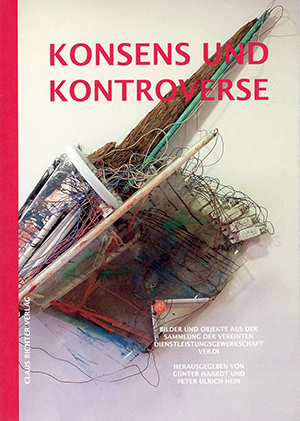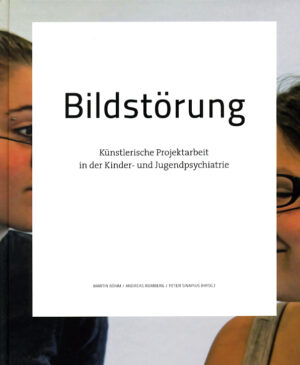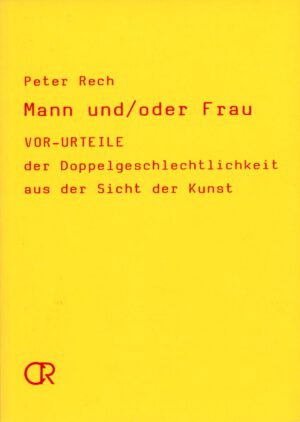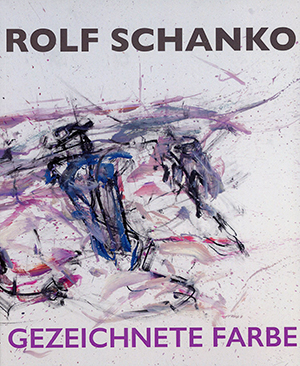Beschreibung
Himmel und Hölle. Sakrale Hinterlassenschaften
im Werk von Sigrid Kopfermann
An den Ambitionen professioneller Sammler hat Hellmut Oelert sich niemals messen wollen. Ebenso fremd ist ihm eine oft anzutreffende Fixierung auf das Neue, so noch nicht Dagewesene. Eher durch Intuition und Zufall, begleitet von Bonhomie und Leidenschaft, fand Bild für Bild seinen Platz im Haus des Mainzer Herzchirurgen. So entstand eine Sammlung, die ein nur wenig erforschtes, gleichwohl wichtiges Anliegen der Malerin Sigrid Kopfermann offenbart. Denn hinter den geflügelten Figuren oder den in luftiger Höhe konstruierten Panoramen verbirgt sich mehr als eine Reverenz an den Großvater, den Flugpionier Otto Lilienthal. Vielmehr kommt hier etwas zur Geltung, das der an formalen Problemen laborierende Kunstdiskurs während der produktiven Jahre der Malerin nur ungern aufnahm, nämlich eine sich der christlichen Ikonologie rückversichernde Spiritualität.
Man könne Bewegung nicht von Anfang und Ende her definieren, so die Meinung zuständiger Philosophen. Dieser Maxime scheint Sigrid Kopfermann im Umgang nicht nur mit der Farbe gefolgt zu sein. Auf der Rückseite einer Leinwand befindet sich der ergänzende Hinweis „Vorwiegend grün“, als wäre es nicht ganz unwahrscheinlich, dass das Grün sich wieder zurückziehen könnte (S. 12). Ein anderer Titel entzieht sich jeder Zielvereinbarung und belässt es beim bloßen Statusbericht: „Alles fließt“ (S. 24). In den meisten Fällen aber führt die abstrakte Malerei der Sigrid Kopfermann einen sehr genau beobachteten Gegenstand mit und versteckt sich nicht hinter minimalistischen Zustandsbeschreibungen. So verschafft sich der Mythos mit der Inszenierung von Engeln, in die Höhe des Gewölbes ragenden Altären sowie dem unaufhaltsamen Fall in die Tiefe eine wiedererkennbare Gestalt. In einem Gespräch bemerkt Hellmut Oelert, er wisse nicht, ob Sigrid Kopfermann gläubig gewesen sei, meint aber in ihren Bildern eine Affinität zum Spirituellen zu erkennen.
Eben dies lässt sich auch über den von der Künstlerin vielfach zitierten, von religiösen Bekenntnissen freien, gleichwohl mit religiösen Begriffen operierenden Auguste Rodin sagen. Es ließe sich die Frage anschließen, wie und warum die Skepsis gegenüber dem Religiösen so oft auf dessen symbolisches Repertoire zurückgreift. …
Aus dem Beitrag von Peter Ulrich Hein